In Claire Legendres Le nénuphar et l’araignée sorgte sich die personale Erzählerin bis zu ihrem 27. Lebensjahr nicht. Auf dem Schulhof der Grundschule wurde ihr der Tod mit 27 vorausgesagt. Bis zu dem Jahr blieben die Sorgen aus. Doch dann endete die Sorglosigkeit und jede Kleinigkeit wurde zum Anlass für Nachforschungen. Vor allem als andere um sie herum verstarben. Und schließlich kommt der Tag, an dem die Angst ihre Berechtigung findet. Während der Untersuchung wurde eine Unstimmigkeit entdeckt, eine OP steht bevor und das Warten auf die endgültige Diagnose einer tödlichen oder nicht tödlichen Krankheit.
Neben der Angst vor einer tödlichen Erkrankung ist das Schreiben Thema. Jeder Autor geht von seinem Leben aus. Das eigene Leben liefert somit nicht nur ausreichend Material, sondern die Geschichten, die daraus entstehen, geben dem eigenen Leben einen Sinn. Darin darf auch die Liebe nicht fehlen. Doch Liebe entgleitet allzu oft. Was bleibt, sind Objekte, die an eine vergangene Liebe erinnern. Sie erhalten die Hoffnung auf eine Rückkehr desjenigen, der gegangen ist.
In 35 Kapiteln und gerade mal auf rund 100 Seiten führt Claire Legendre den Leser in das Leben ihrer Protagonistin, die seit ihrem 13. Lebensjahr raucht, die die Gefahr aus dem Inneren kommen sieht und nicht aus einer womöglich gefährdenden Umgebung.
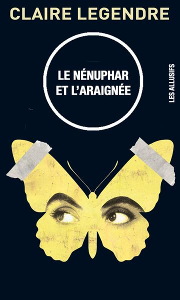
Roman
Les Allusifs, 2015
104 Seiten
15,95 $
« Une chose est particulière aux romanciers : nous écrivons des histoires à partir des nôtres, et ce faisant nous donnons du sens aux nôtres, qui n’en ont pas. Chaque geste, chaque parole fait sens. Comme dans un Hitchcock un insert sur l’arme du crime nous la désigne pour ce qu’elle sera. Nous regardons ainsi notre vie, au moment de la vivre, avec cet appétit rétrospectif anticipé d’instiller du sens à ce qui en est pour l’instant dépourvu. Nous essayons de deviner la suite. C’est un orgueil déraisonnable : nous nous prenons pour Dieu.
Je n’écris pas ‹ nous › d’habitude mais je sais, ici, que je ne suis pas seule. Je connais suffisamment de personnes qui jouent comme moi à se prendre pour Dieu en fiction, en écriture. Qui manipulent comme moi des figurines qui leur ressemblent trait pour trait. Ceux que je fréquente sont athées. C’est pour cela qu’ils jouent à être Dieu. Pour en pallier l’absence. Pour imaginer que nous ne vivons pas en vain. Pour que ce qui se dérobe à l’entendement tous les jours trouve, fût-ce absurdement, noir sur blanc, une signification de fortune. Pour s’arracher au dérisoire. De force. » – Claire Legendre: Le nénuphar et l’araignée, Les Allusifs, 2015, S. 20
